Die Philosophie vom Herzensgrund
Grundzüge der Philosophie vom Herzensgrund
• Die Philosophie vom Herzensgrund stellt das Fühlen ins Zentrum des menschlichen Seins, nicht das Denken. Sie versteht sich als Gegenentwurf zu rein
rationalistischen oder abstrakten Philosophien.
• Sie basiert auf der Phänomenologie der jüdisch-deutschen Philosophen Theodor Lessing, Max Scheler, Martin Buber und Erwin Straus, dem
Spielbegriff Friedrich Schillers und der Herzensphilosophie Blaise Pascals und führt die Philosophie nach Jahrhunderten der Verstiegenheit in den Kopf wieder zurück zur Weisheit des
Herzens.
• Sie weist nach, dass das Herz der eigentliche Ort unseres Wirklichkeitsbezuges ist, nicht der Kopf. Damit findet die Philosophie ihre Fundierung wieder in der Mitte des Menschen und nicht in einem seiner Pole.
• Die Philosophie vom Herzensgrund erforscht tiefere Räume des menschlichen Daseins; Räume, die jeder Mensch fühlend erfährt, Räume im Zwischenmenschlichen, Räume zwischen Mensch und Natur, Räume in der Tiefe der eigenen Seele.
• Die Philosophie vom Herzensgrund bedient sich einer einfachen, klaren Sprache, weil sie für jeden Menschen verständlich sein möchte. Sie setzt sich damit ausdrücklich von der kategorisierenden und normativen Sprache des intellektuellen Diskurses und akademischer Philosophie ab. Dem entsprechend entwickelt sie sich nicht allein in philosophischen Studien und Untersuchungen, sondern auch in literarisch-poetischen Schreibweisen wie Aphorismen, Tagebuch, Meditationen, Gedichten usw.
• Die Philosophie vom Herzensgrund ist zugleich Grundlage für eine therapeutische Arbeit, die von der Empathie ausgeht und den Menschen als ein Wesen begreift, das unendlich entwickelungsfähig ist und nach positiver Weiterentwicklung strebt, selbst wenn die Hindernisse noch so schwer sind.
Kernthesen
• Anthropologische Fundierung im Herzen: Das Herz ist Zentrum des Menschen, nicht der Kopf.
• Ausgangspunkt im Erleben: Die Philosophie beginnt im Erleben und nicht in der intellektuell-rationalen Erkenntnis.
• Ursprung im Verbundensein: Alles Dasein beginnt im Verbundensein, nicht erst mit dem Erwachen des individuellen Bewusstseins.
• Verwandlung als Grundprozess des Daseins: Das menschliche Leben ist ein Prozess stetiger Verwandlung. Wir verwandeln die Welt und die Welt
verwandelt uns.
• Fühlen und Empathie als Fluidum: Das Fühlen und die Empathie sind das Fluidum des seelischen Lebens.
• Spielen im Kunstschaffen: Das Spielen ist der Kernprozess des Kunstschaffen. Das Kunstschaffen ist der
Kernprozess lebendiger Verwandlung und Weiterentwicklung des Menschen und damit eine gesteigerte Form eines positiv-produktiven Lebensvollzugs.
• Selbstentwicklung in der Spannung zwischen Wir und Ich: Entwicklung geschieht im lebendigen Spiel zwischen Gemeinschaft und Individualität,
zwischen der Hingabe an das Wir und dem subjektiven Erwachen im Ich.
• Demut des Denkens: Das Denken ist ein Werkzeug der Weiterentwicklung, nicht etwa ontologische Erkenntnisbasis.
• Sokratische Infragestellung und Ideologiekritik: Ohne Kritik am Falschen, ohne Widerstand gegen Schädliches gibt es keine positive
Weiterentwicklung.
• Empathische Wissenschaft: Auch die rein rationale wissenschaftliche Forschung basiert auf dem Eingefühltsein des Menschen in seine Umwelt, selbst wenn sie es nicht zugeben will. Die gegenwärtige Wissenschaft hat hier einen blinden Fleck.
• Gegenwartsgestaltung: Ausrichtung auf die aktive, positive Verwandlung der Welt und des Selbst durch Empathie, Fühlen, Spielen und Phantasie als Heilungsprozess, anstelle des immer wieder herbeigeleierten Zukunftsdenkens, das doch nie zu positiver Veränderung geführt hat.
Stand: 15.6.2025

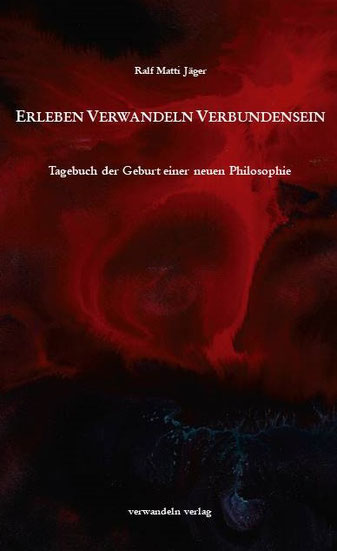
Erleben Verwandeln Verbundensein
Tagebuch der Geburt einer neuen Philosophie
Einleitung
von Ralf Matti Jäger
Online-Publikation der Einleitung
In diesen Buch ereignet sich die Geburt der Philosophie vom Herzensgrund. Es ist das Grundbuch einer neuen Philosophie, die nicht vom Denken,
sondern vom Herzen als dem Schlüssel zur Wirklichkeit ausgeht, zugleich eine Kritik der gegenwärtigen Philosophie, insoweit sie unreflektiert das Denken in den Mittelpunkt
stellt.
Da die Einleitung des Buches eine grundlegende Orientierung über die Philosophie vom Herzensgrund bietet, soll sie
hier online veröffentlicht werden, auch wenn ich das gesamte Buch von 587 Seiten aus Kostengründen noch nicht drucken lassen kann.
Ralf Matti Jäger am 11.7.2022
Zuletzt aktualisiert am 9.5.2025
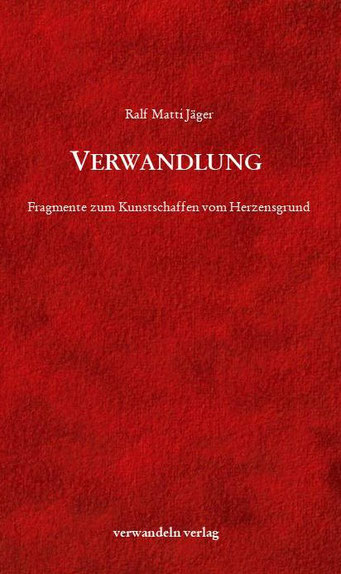
Verwandlung
Fragmente zum Kunstschaffen vom Herzensgrund
von Ralf Matti Jäger
Taschenbuch, broschiert, 12x21cm, 140 Seiten.
ISBN 978-3-9819259-1-3.
19,80€ + Versandkosten
Das menschliche Leben ist ein Prozess stetiger Verwandlung: Wir verwandeln die Welt und die Welt verwandelt uns.
Der Kernprozess aller Verwandlung ist das Kunstschaffen. Der malende Mensch, sei es ein Kind, ein Patient, ein Künstler, verwandelt die Welt der Farben, aber die Farbenwelt verwandelt auch ihn. Der tanzende Mensch verwandelt die Welt der Bewegung, des Rhythmus, des Raumes und diese verwandeln auch ihn. Der musizierende Mensch verwandelt die Klänge, Rhythmen, Töne, Geräusche, diese verwandeln auch ihn. Das Kunstschaffen ist ein Prozess der Anverwandlung von Mensch und Welt. Da ist ein Zusammenfließen und Eins-werden, und auch wieder ein Auseinanderfließen und Zwei-Werden.
In Aphorismen, Notizen, Fragmenten und Essays versuche ich das Kunstschaffen als Prozess des Spielens zwischen Individualisierung und Kommunion, als Prozess der Welt- und Selbstverwandlung zu beschreiben.
Es geht um Verwandlungs-, Veränderungs- und Entwicklungsprozesse im (kunstschaffenden) Menschen.
Zuletzt aktualisiert am 9.10.2024
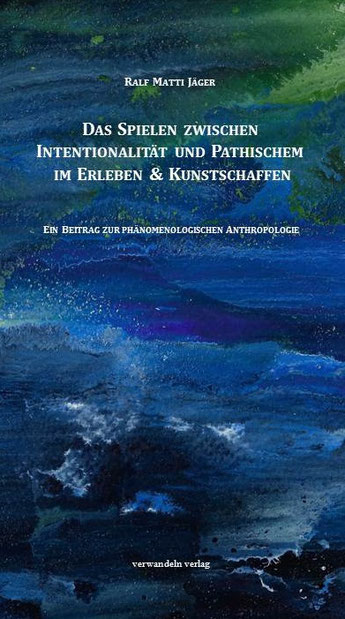
Das Spielen zwischen Intentionalität und Pathischem im Erleben & Kunstschaffen
Ein Beitrag zur phänomenologischen Anthropologie
von Ralf Matti Jäger
Welche Prozesse vollziehen sich zwischen Mensch und Welt, wenn wir die Welt und uns selbst darin erleben? Welche Prozesse vollziehen sich im Handlungs- und Wahrnehmungsfeld des Kunstschaffens? Diese beiden Fragen bilden den gemeinsamen Ausgangspunkt dieser philosophisch-phänomenologischen Studie.
In dem Buch wird das Spielen zwischen Intentionalität und Pathischem als apriorischer Grundprozess des menschlichen Erlebens und des Kunstschaffens in einem Dreischritt von Husserls Intentionalitätsbegriff über Straus‘ Begriff des Pathischen zum Spielbegriff Schillers begrifflich entwickelt.
Sodann wird der Prozess des Spielens zwischen Intentionalität und Pathischem anhand der taktilen Berührung, der Sinneswahrnehmung und des Fühlens, sowie des Plastizierens und Malens anschaulich gemacht.
Auf dieser Grundlage wird abschließend anhand von Ausführungen Albert Einsteins auf die großen Ähnlichkeiten und die kleinen, aber gewichtigen Unterschiede zwischen dem Kunstschaffensprozesses und dem kreativen Denkprozess des Wissenschaftlers hingewiesen.
Taschenbuch, broschiert, 12x21cm, 139 Seiten
ISBN 978-3-9819259-0-6.
19,80€ + Versandkosten
Zuletzt aktualisiert am 9.5.2025
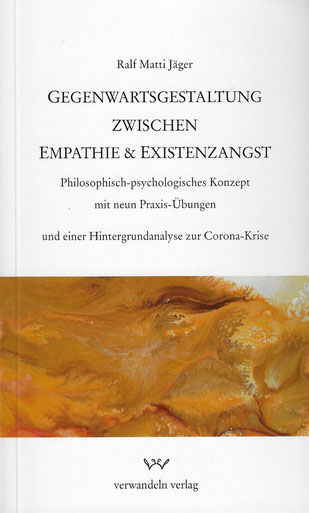
Gegenwartsgestaltung zwischen Empathie & Existenzangst
Philosophisch-psychologisches Konzept mit neun Praxisübungen
und einer Hintergrundanalyse zur Corona-Krise
von Ralf Matti Jäger
Taschenbuch, broschiert, 10,6x17,5cm, 227 Seiten, mit 9 Malereien
ISBN 978-3-9819259-5-1
12€ + Versandkosten
Warum sind wir europäisierten Menschen mit all unserem Intellekt, unserer Wissenschaft und Technik zu Zerstörern unseres Planeten und damit unserer selbst geworden? Und wie können wir uns als Einzelne und als Gemeinschaft so verwandeln, dass wir eine andere innere Haltung, ein anderes Verhältnis zur Natur, zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen finden können?
Im Versuch, Antworten auf diese Fragen zu finden, habe ich einerseits ein philosophisch-psychologisches Konzept entwickelt, das uns erklären soll, wie wir seelisch funktionieren und warum wir immer wieder in Einseitigkeiten hineingeraten.
Andererseits habe ich Übungen entwickelt, die jeder selbst machen kann. Das sind Übungen zur leiblichen Selbstempathie, zur emotionalen Selbstempathie und zur zwischenmenschlichen Empathie.Auf der anderen Seite sind es Übungen zur Einsamkeit, zur Selbstreflexion und zum Widerstand.
Im Zentrum aber stehen die Übungen zum Spielen zwischen den Polaritäten. Wer spielen kann, wird anders handeln. Spielend wird eine positive Gegenwartsgestaltung möglich.
Ralf Matti Jäger am 8.10.2021
Zuletzt aktualisiert am 9.5.2025
© ralf matti jäger verwandeln verlag
